Wer schreibt, der kennt die Situation im Angesicht des Nichts. Der Tisch wird zu einem leeren Strand. Mit dem ersten Wort auf dem leeren Papier hat man das Gefühl, man springe ins kalte Meer. Es ist ein langwieriger Häutungsprozesses, den das literarische Schreiben bedeutet. Das ist immer noch ein Wunder für Francisca Ricinski. Sie kann sich mit nichts an einen Tisch setzen, und von irgendwoher kommt dieses Etwas, das vielleicht einmal zu einem Buch wird. Schreiben ist die beste Möglichkeit, um Personen, Handlungen und Konflikte verstehen zu lernen, Motive können nur aufrühren, wenn es Motive von Fall, Flucht und Verfolgung, von Gleichgültigkeit, Auflehnung und verfehlter Lebensgründung sind. Die Aufgabe der Poesie ist die Entdeckung des Typischen im Exzeptionellen. Die Wahrheit der Paradoxie steckt auch in den Texten der am 18. November 1943 in Tupilati / Rumänien geborenen Autorin Francisca Ricinski; sie müssen gegen den Strich gelesen werden. Die Grenzen zwischen Poesie und Prosa sind bei Francisca Ricinski fließend: Im Traum vermischen sich Lied und Notiz; die Lyrikerin mutiert zur Tagebuchschreiberin; die Reflexion fällt der poésie pure ins Wort. Francisca Ricinski knüpft an eine literarische Tradition der europäischen Moderne an, die E. M. Ciorans »Lehre vom Zerfall« ebenso verpflichtet ist wie dem Dichter Mihai Eminescu.
Langfristig gesehen geht es Autoren oft besser, wenn sie nie im Trend lagen – dann können sie auch nicht aus der Mode kommen. Dazu noch sind solche Künstler möglicherweise seelisch gesünder. Francisca Ricinski schreibt Lyrik, Theaterstücke, Erzählprosa, Essays, sie ist eine hervorragende Übersetzerin und hat sich um die Propagierung zu wenig beachteter Schriftsteller verdient gemacht. Sie sucht nicht die Öffentlichkeit des Literaturbetriebs, macht sich rar, wo es lärmend zugeht. Eher trifft man sie in den bisweilen elitären Kreisen des "Dichtungsrings", des "Philotast", des "Krautgartens", der "Eremitage" und "der Matrix". Dies mag mit ihren Wurzeln zu tun haben. Ihr Vater, ein Pole mit französischen Ahnen, ihre Mutter, eine Rumänin, aus dem Nordosten des Landes, unweit von Bukowina des Paul Celan und Rose Ausländer. Ihre Prosa handelt vom Auswandern, von der Liebe, der Macht zufälliger Begegnungen und der Brüchigkeit von Identität. An der Schwarzmeerküste schrieb Ovid seine Tristium libri, traurige Gesänge der Sehnsucht nach Rom, hier lebte Puschkin in einigermaßen komfortabler Verbannung, und 1919 verließ von der Krim aus der junge Nabokow sein Heimatland. Identität entsteht bei Francisca Ricinski nicht aus der Gewissheit eines lückenlosen Stammbaums, sondern aus einer Schlüsselerfahrung des 20. Jahrhunderts: dem Exil. Aus der alten Strafe des Heimatverlusts und der Entwurzelung, aus der nach dem 2. Weltkrieg eine Verschiebung von Menschenmassen kreuz und quer durch Europa wurde. 1980 verließ sie das Land und übersiedelte aus familiären Gründen nach Bonn. Die Erfahrung von Fremdheit, der Zusammenprall von Menschen, Kulturen, Sprachen und Zeiten bestimmt den Grundton ihrer Schriften. Hier ist alles Erfundene wahr ist und alles Wahre erfunden. Als Hybrid eignete sie sich zwischen dem Schwarzen Meer und dem Rhein die deutsche Sprache an. Ähnlich wie die Kolleginnen Herta Müller und Ioona Rauschan schreitet sie diese Sprachräume in suchenden Bewegungen aus.
Man braucht ein Ohr zur Sprache. Francisca Ricinski hat nie versucht, den sprachlichen Modismen zu folgen. Der sicherste Weg ins Unmoderne ist, das Moderne zu pflegen, weil man das morgen nicht mehr hören kann. Anhaltspunkte aus der menschlichen Wirklichkeit. Ihre Figuren sind in das Mahlwerk einer übergroßen zerstörerischen Macht geraten. Sie haben überlebt, doch nun sind ihnen Bilder eingebrannt. In zahlreichen, oft kaum merklichen Rückblenden eines zurückhaltenden Erzählers macht sich der Klammergriff bemerkbar, in dem diese Bilder die Gegenwart halten. Unbekümmert, mit feinem stilistischem Gespür mischt sie Genres, verbindet Analysen mit Impressionen, gleitet vom Heute ins Gestern und wieder zurück. Francisca Ricinski schreibt präzise und sensibel, sie versteht es, die große Geschichte mit der kleinen zu verschränken, das Persönliche ins Allgemeine laufen oder besser: stürzen zu lassen. Wenige Skizzen reichen ihr, ihren Protagonisten ein persönliches Antlitz zu geben. Nichts scheut sie so sehr wie das Pathos des Individuellen, die Überfrachtung der Poesie mit Unmengen von Privatem, auf das der Leser auch ja verstehe, welch einzigartiger Mensch da verloren geht. Aufdringliche Privatmythologie ist ihre Sache nicht, die Texte bleiben schlank. Es gibt bei ihr eine Einfachheit der Sprache, eine Natürlichkeit der Dialoge, die den Abstand zur Literatur geringer erscheinen lässt. Dabei müssen die Menschen nicht unbedingt so sprechen wie „im richtigen Leben“. Aber man spürt, daß die Worte, Sätze, die Francisca Ricinski für sie schreibt, ihnen entsprechen.
Bestechend in ihrer Andersartigkeit und von hohem ästhetischem Reiz sind die kurzen Geschichten und poetischen Splitter in dem Band »Auf silikonweichen Pfoten«. Erzählungsbände fordern vom Leser mehr Konzentration als Romane: immer neue Namen, immer neue Konflikte. Auf den ersten Blick wirken diese Texte wie kleine Knäuel. Die Gedanken und Sätze laufen hier in verschiedene Richtungen, scheinen weder Anfang noch Ende zu haben. Das alles ist mehr als erträglich, weil Francisca Ricinski dafür eine Sprache hat, die sich auf nichts ausschließlich einlässt, sondern immer mit Augenzwinkern erzählt. Bisweilen machen ihre Sätze Faxen, springen von hier nach dort, wieder zurück und auch mal absichtsvoll daneben. Über feine Wortschleifen und Bedeutungsverschiebungen verschlingt diese Rede sich immerzu neu – und läuft doch voran. Ein wundersames Buch. Und sehr anders. Handlung gibt es fast keine, dafür handelt es von umso gewichtigeren Dingen, vom Leben zum Beispiel und vom Tod und den Toten und davon, was das alles miteinander zu tun hat. Über alldem und um all das herum bilden Humor und Traurigkeit eine Dichotomie, die das Ganze auch da, wo es wirklich ernst ist – und wahrscheinlich ist es das fast das ganze Buch über –, nicht ins Bierernste kippen lässt. Ihre Prosa ist raffiniert genug, seine Form nicht einfach zu behaupten, sondern auch zu zeigen, was sie überwinden will. Ihre Sätze wirken wie kleine Maiskörner, um die herum immer mehr Wörter, Wortgruppen und Nebensätze gepackt werden, bis sie zu großartigem, buttrig–salzigem Popcorn explodieren. Der Autorin verschafft dies die Möglichkeit, Vorlieben und Obsessionen auf verschiedene Weisen zu umkreisen. Unter lauter Metaphern verschwindet zuweilen der Kern. Und zum Kern ihres ureigenen Kosmos findet Francisca Ricinski zurück durch Besinnung – auf sich selbst. Der Band ist zudem klug zusammengestellt, und dies fügt die Komposition den Geschichten einen doppelten Boden hinzu. Locker rollt Francisca Ricinski ihre Gedanken auf, von Absatz zu Absatz, von Text zu Text. Und immer kunstvoller variiert sie dabei die Sätze. Für Momente bringt die Sprechende ihre Sätze ins Gleichgewicht, um sie flugs wieder zu verschieben und neu auszurichten. Ihre Themen – die Liebe, das Erotische, das Versöhnliche – scheinen nur noch ex negativo als etwas schmerzlich Abwesendes beschreibbar. Wer ihren besonderen Ton schätzt, jene Mischung aus Märchenanklängen, sprachschöpferischem Furor, gepflegter Schnoddrigkeit und etwas manierierter Erdenschwere, der wird mit den silikonweichen Pfoten erstklassig bedient. Durchgehend erweist sie sich als Meisterin des zwar nicht düsteren, aber doch gedrückten Tons. Eines Stils, der traurig, aber niemals sentimental ist. In der vermeintlichen Nähe zeigt sich zugleich die Ferne. Gegen Ende wird der Ton dieser Kurzgeschichten ambivalent: Härte, gedämpft durch Sentimentalität; Grobheiten mit einer Beimischung von Herzensgüte. Dem Spiegelkabinett können wir bei Francisca Ricinski nicht entrinnen. Das es ist der Kern ihres Denkens: Versöhnung von sich ausschließenden Kräften, sie zeigt, daß die Seele mit der Zauberkraft der Kunst und der Phantasie überleben kann.
Sie krampft sich nichts ab, eher schüttelt sie ein paar Zeilen aus dem Ärmel. Francisca Ricinski richtet den performativen Blick auf die Endlichkeit des Lebens, sie bietet dessen Eitelkeiten als ein oft Karnevaleckes, immer jedoch als theatralisches Proszenium dar. Was sich von selbst versteht, muß nicht eigens verstanden werden. Das ist praktisch. Es ist die Praxis des alltäglichen Zusammenlebens. Andererseits schwebt das Selbstverständliche darum stets in der Gefahr, unverstanden zu bleiben. In solcher Gefahr ist diese Prosa in ihrem Element. Sie sucht das Unverstandene und Unselbstverständliche im Selbstverständlichen auf, um das Selbstverständliche besser zu verstehen. Es ist nie auszuschließen, daß sie dabei Befremden erzeugt.
Francisca Ricinski stellt die alten Grundfragen, daran, was Poesie will: Als Ethik des unbedingten Sollens ignoriert sie die Eingebundenheit der einzelnen Subjekte in die sozialen Verhältnisse und konfrontiert sie mit idealen Forderungen, deren grundsätzliche Erfüllbarkeit sie einfach voraussetzt. Als Ethik des guten Lebens ignoriert sie die Frage des einzelnen, was für einer er sein will, indem sie ihn mit dem allgemeinen Begriff einer vernünftigen Lebensform abspeist. Francisca Ricinskis Handschrift ist eine Kennung, ein Ausweis, ein Biorhythmus. Deshalb frei nach Walter Benjamin: Man möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen – bevor es andere tun. Ein Stoßseufzer post festum, sicherlich. Dennoch möge er gehört werden.
Matthias Hagedorn
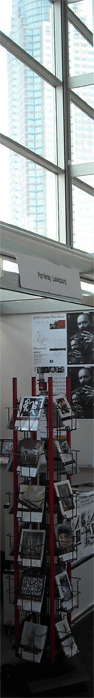

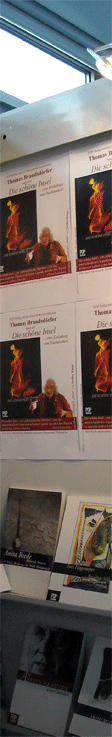
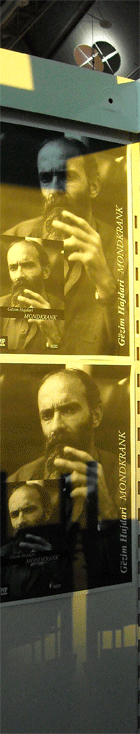



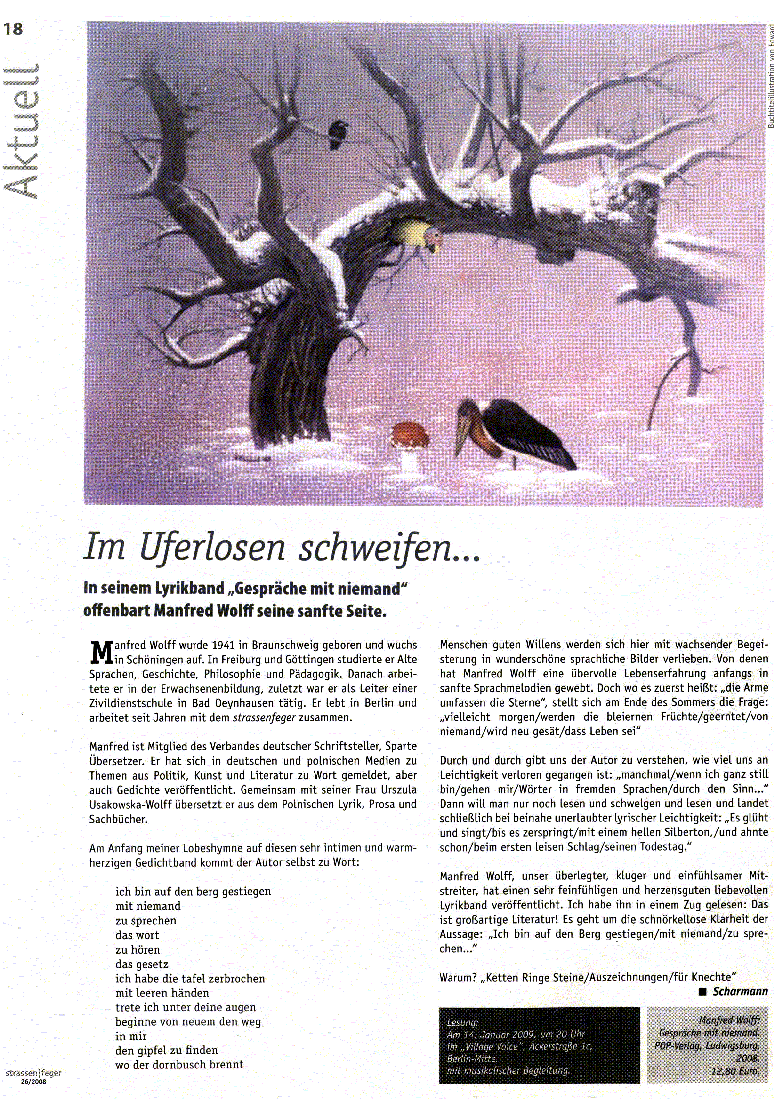
 Petra Kelly ist vielen heute noch Vorbild mit ihrem unbedingten Einsatz für
eine Sache; darin, wie sie sich die Sache des Friedens, des sozialen Ausgleichs,
aber eben auch des Kampfes für die Benachteiligten – und zu diesen gehören
auch die kranken Kinder – ganz zueigen gemacht hat, so sehr, dass sie alle
anderen, eigenen Interessen hintanstellte. Der 14. Dalai Lama ist heute weltweit
ein Vorbild für viele geworden – seine Sanftheit und zugleich Bestimmtheit,
mit der er sein Ziel, Erleichterung für Tibet zu erreichen, verfolgt. Dafür,
dass er selbst auf jeden Ausdruck von Gewalt verzichtet und dies auch von seinen
Anhängern fordert. Darin stellt er sich bewusst nicht auf die Seite der Mächtigen
der Welt – und wird doch dadurch zum Vorbild für viele, denen die Augen geöffnet
werden, wie Auseinandersetzung und letztlich Politik auch vor sich gehen könnten.
(Aus dem Vorwort von Uli Rothfuss). Das Buch erschien zum 35jährigen Bestehen
der Grace P. Kelly – Vereinigung zur Unterstützung von krebskranken Kindern
und Ihren Familien und wurde von Uli Rothfuss, Mitglied im Kuratorium der
Vereinigung, herausgegeben. Der Erlös kommt der Vereinigung zugute. Uli
Rothfuss (Hrsg.): Tu es, fang an, und die Welt wird sich ändern! Gedanken von
Petra Kelly und seiner Heiligkeit, dem XIV. Dalai Lama. Brosch., 62 S.,
Pop-Verlag, Ludwigsburg 2008.
Petra Kelly ist vielen heute noch Vorbild mit ihrem unbedingten Einsatz für
eine Sache; darin, wie sie sich die Sache des Friedens, des sozialen Ausgleichs,
aber eben auch des Kampfes für die Benachteiligten – und zu diesen gehören
auch die kranken Kinder – ganz zueigen gemacht hat, so sehr, dass sie alle
anderen, eigenen Interessen hintanstellte. Der 14. Dalai Lama ist heute weltweit
ein Vorbild für viele geworden – seine Sanftheit und zugleich Bestimmtheit,
mit der er sein Ziel, Erleichterung für Tibet zu erreichen, verfolgt. Dafür,
dass er selbst auf jeden Ausdruck von Gewalt verzichtet und dies auch von seinen
Anhängern fordert. Darin stellt er sich bewusst nicht auf die Seite der Mächtigen
der Welt – und wird doch dadurch zum Vorbild für viele, denen die Augen geöffnet
werden, wie Auseinandersetzung und letztlich Politik auch vor sich gehen könnten.
(Aus dem Vorwort von Uli Rothfuss). Das Buch erschien zum 35jährigen Bestehen
der Grace P. Kelly – Vereinigung zur Unterstützung von krebskranken Kindern
und Ihren Familien und wurde von Uli Rothfuss, Mitglied im Kuratorium der
Vereinigung, herausgegeben. Der Erlös kommt der Vereinigung zugute. Uli
Rothfuss (Hrsg.): Tu es, fang an, und die Welt wird sich ändern! Gedanken von
Petra Kelly und seiner Heiligkeit, dem XIV. Dalai Lama. Brosch., 62 S.,
Pop-Verlag, Ludwigsburg 2008.